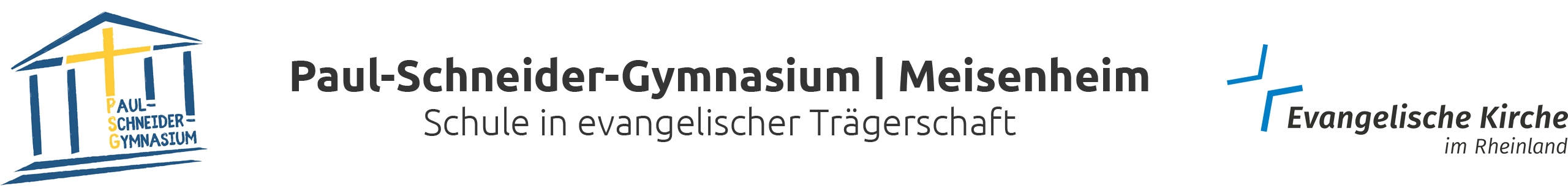„Liebe Mutter,
ich schreibe Dir diesen Brief am 21. Februar um 14 Uhr. Die Artillerie hat bereits seit 8 Uhr mit den größten Geschützen zu schießen begonnen, den 42-, 38- und 30-cm-Minenwerfern. Es wird hier einen Kampf geben, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Hoffen wir, dass unser Unternehmen erfolgreich ist und dass Gott uns beisteht. Wir sind für die größte Aufgabe bestimmt, die vielleicht die Entscheidung in diesem schrecklichen Kampf bringen wird.“
Dies schrieb ein deutscher Soldat im Jahr 1916 an dem Tag an seine Mutter, an dem von deutschen Soldaten die Schlacht um Verdun eröffnet wurde. Seit dem Sieg im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 hatte das Deutsche Reich das Elsass und Lothringen als sogenanntes Reichsland in seinem Besitz. Die Franzosen wiederum hatten nach ihrer Niederlage unter der Führung von General Séré de Rivières zum Schutz der neuen Ostgrenze eine neue Linie von Befestigungsanlagen errichtet, die „barriére de fer“. Zentraler Bestandteil dieser „Eisenlinie“ sollte das von zahlreichen Forts gesicherte Verdun sein. Als nun das Deutsche Reich am 1. August 1914 Frankreich den Krieg erklärte und gemäß dem Schlieffenplan über das neutrale Belgien von Norden her nach Frankreich einfiel, war die Festungsstadt Verdun von besonderer strategischer Bedeutung. Was sich ab dem 21. Februar 1916 dort ereignete, hatte die Welt tatsächlich noch nicht gesehen. Als Erfolg konnten aber weder die Deutschen noch die Franzosen die bis zum 19. Dezember 1916 andauernde Schlacht von Verdun verbuchen, weist die Bilanz doch nach 300 Tagen und Nächten mindestens 300.000 Tote und Vermisste sowie 400.000 Verletzte auf, psychische Erkrankungen infolge der Kriegshandlungen nicht berücksichtigt.
Um den Schülerinnen und Schülern der MSS 12 gerade in Zeiten, die von zahlreichen Krisen und Kriegen geprägt sind, nicht nur die Grauen des Ersten Weltkrieges zu verdeutlichen, sondern vor allem auch, wie verheerend ein übersteigerter Nationalismus und Großmachtfantasien und wie fragil andererseits Frieden und Freiheit sein können, machten wir uns schon in den frühen Morgenstunden auf die über dreistündige Fahrt in unser Nachbarland.
Nach der Ankunft schlenderten einige bei schon mehr als 30 Grad vom Parkplatz des Mémorial de Verdun zur Anlage des früheren Dorfes Fleury-devant-Douaumont, das wie acht weitere Dörfer im Umkreis durch die Kriegshandlungen 1916 gänzlich zerstört und nicht mehr aufgebaut wurde. Auffällig auf dem kurzen Weg dorthin ist die von trichterförmigen Vertiefungen geprägte Landschaft, eine von Gras bedeckte Erinnerung an die durch den Einschlag von ca. 50 Millionen Bomben und Granaten entstandene Mondlandschaft des Krieges.
Im Anschluss besuchte eine Gruppe zunächst das Mémorial de Verdun, während die andere Gruppe weiter zum Fort de Douaumont fuhr.
Das Mémorial de Verdun, ein Museum, das sich ganz besonders der Schlacht um Verdun widmet, aber auch den Ersten Weltkrieg im Ganzen thematisiert, erstreckt sich über drei Etagen und zeigt eine facettenreiche Ausstellung von Dokumenten und Sachquellen aller Art. So sind z. B. die Ausstattung der deutschen und französischen Soldaten von der Feldflasche bis zur Schusswaffe, Briefe und Plakate, aber auch Kriegsgerät wie Geschütze oder ein Flug-zeug zu sehen. Mehrere Sitzgelegenheiten bieten die Möglichkeit, konzentriert einem Video-beitrag zu folgen oder einfach nur in einem Moment der Ruhe die Eindrücke wirken zu lassen.
In Sichtweite zum Mémorial de Verdun liegt das Fort de Douaumont, das größte und eindrucksvollste Fort rund um Verdun, das während des Krieges zunächst recht schnell und überraschenderweise ohne Widerstand von den Deutschen eingenommen und im Laufe des Jahres 1916 von den Franzosen wieder zurückerobert worden war. Bei einer Führung durch die dunklen, nassen Räumlichkeiten bekamen wir einen Einblick in das von Entbehrung und ständiger Furcht geprägte Leben im Fort. Besonderen Eindruck hinterließen der große Geschützturm sowie die Gedenkstätte für die deutschen Soldaten, die bei einer Explosion und dem folgenden Brand gestorben, aufgrund der Kriegshandlungen aber nur hinter einer auf der Ringstraße errichteten Mauer bestattet worden waren.
Nach diesem beeindruckenden und zugleich beklemmenden Erlebnis stand der Besuch des Beinhauses und des Soldatenfriedhofes an. Während auf dem Nationalfriedhof etwas mehr als 16.000 Gräber von französischen Soldaten zu finden sind, lagern im Beinhaus die Gebeine von über 130.000 nicht identifizierten deutschen und französischen Soldaten. Eine bedrückende Vorstellung, dass da, wo wir bei Sonnenschein und blauem Himmel in aller Ruhe herumschlenderten, Hunderttausende von jungen Menschen als Werkzeuge ihrer Regie-rungen, aber auch infolge nationaler Begeisterung im „Großen Krieg“ ihr Leben gelassen hatten.
Durchgeschwitzt und unter dem Eindruck des Erlebten bestiegen wir am späten Nachmittag wieder unseren Bus und erreichten schließlich gegen 20:00 Uhr Meisenheim – im Gepäck eine Reihe von Bildern eines Ereignisses, das für Europäer nach dem Zweiten Weltkrieg, der folgenden deutsch-französischen Aussöhnung und dem Ende des Kalten Krieges so weit entfernt schien und nun in Zeiten des Ukraine-Krieges oder der Kriege im Nahen Osten zwischen Israel und der Hamas, der Hisbollah und dem Iran näher gerückt und greifbarer geworden ist.
Wie eindrücklich und lehrreich Fahrten wie diese für junge Menschen sind und welche Konsequenzen sie für ihr Denken und Handeln daraus ableiten, wird die Zukunft zeigen…
+ Benjamin Emrich (Fachschaft Geschichte)